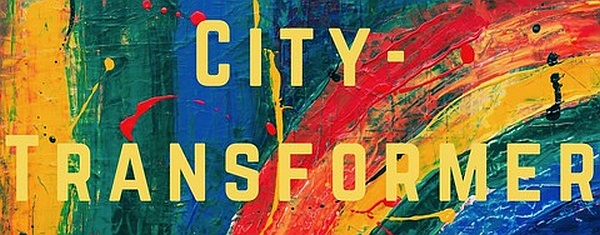
City-Transformer mit Franz-Reinhard Habbel und Michael Lobeck
Transkript
Den Staat von morgen bauen - Arne Treves über das Projekt Re:Form
City-Transformer Episode 42
Transkript
Habbel:[0:01] Wir begrüßen Sie zur inzwischen 42. Ausgabe des Podcast City Transformer. Schön, dass Sie auch diese Folge hören. Wir, das sind Franz Reinhard Habbel und Michael Lobeck. Heute geht es um einen sinnvollen Wandel im Verwaltungswesen, um den Start von morgen. Wir sprechen mit Arne Treves. Er ist Mitinitiator von Re:Form, der Allianz für den Staat von morgen. Und Teil des Leadership von projecttogether. Er wird sich gleich noch näher vorstellen, aber zunächst, lieber Michael, die obligatorische Frage, was gibt es Neues?Lobeck:[0:40] Ja, Neues ist bei mir im Moment die Auseinandersetzung mit dem drohenden Ende von Windows 10 Support. Und ich hadere noch damit, wie mache ich das? Kaufe ich einen neuen Rechner und besorge mir Windows 11? Also mein alter Laptop darf nicht mehr. Es könnte es meiner Ansicht nach, aber es darf nicht mehr aus Windows-Sicht. Also kaufe ich einen neuen und packe Windows 11 drauf oder wechsle ich in die Apfelfraktion oder sage ich, ihr könnt mich alle mal und jetzt beschäftige mich endlich mal mit Linux, weil das kann dieses alte Schätzchen ganz bestimmt auch ohne Performanceeinbußen. Also das ist eine Sache, die mich bewegt und das ist insofern auch nochmal interessant, weil wir hatten auch beim letzten Mal schon so ein paar Dinge, die immer die digitale Souveränität betreffen. Da gab es jetzt auch gerade nochmal eine Antwort des Digitalministeriums auf eine Anfrage, dass auch das Digitalministerium davon ausgeht, dass Deutschland an der einen oder anderen Stelle nicht so souverän ist, wie sie es gerne wollen.Lobeck:[1:41] Und dazu passend gibt es auch noch gerade das Urteil zur Facebook-Fanpage der Bundesregierung, was ihnen erstmal erlaubt, diese Fanpage zu betreiben, aber wo die Beauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit gesagt hat, ja gut, das will ich jetzt trotzdem, werde ich nochmal eine Etage weitergehen, um das endgültig zu klären und um Rechtssicherheit zu schaffen. Und ich finde, das passt alles gut zueinander, diese Fragen. Und das bewegt mich gerade. Das ist das Neue im Moment für mich. Was hast du noch, Franz Reinhard?Habbel:[2:17] Ja, es gibt ja noch eine weitere Alternative. Du könntest ja auch wieder zu Block und Bleistift zurückkehren.Lobeck:[2:22] Ja, das ist natürlich auch eine Idee. Das stimmt. Das habe ich noch nicht so richtig erwogen. Ich schreibe es mir mal auf den Zettel. Das kann ich in meine Abwägung dann mit einbeziehen.Habbel:[2:31] Ja, ich will mal den Blick ein bisschen nach vorne richten und auf den Herbst der Reformen zu sprechen kommen, der ja im Mittelpunkt gerade der Politik steht, gerade auch was die Sozialpolitik betrifft. Land auf und Land ab hören wir von notwendigen Einschnitten. Wir haben kein Geld mehr, um alles zu bezahlen, von Steuererhöhungen für die Reichen. Es darf keine Leistungskürzungen geben. Die Errungenschaften des Sozialstaates dürfen nicht aufgegeben werden und so weiter und so fort. Es sind die üblichen Rituale, Kommissionen werden angekündigt, Vorschläge sollen gemacht werden. Mich wundert etwas, dass keiner über den Verwaltungsaufwand, über die Ausbreitung von Regelungen, über Bürokratie, über zu viele Akteure und Ineffizienzen diskutiert. Wir haben nämlich eine Sozialbürokratie ungeahnten Ausmaßes. Die Verwaltungskosten für das Bürgergeld allein stiegen in den letzten zehn Jahren um 39 Prozent auf inzwischen 6,5 Milliarden Euro.Habbel:[3:31] Die Sozialversicherungen in Deutschland verursachen jährlich rund 25 Milliarden Euro an Verwaltungskosten. Nehmen wir nur die beiden Zahlen mal zusammen, sind wir etwas mehr bei 30 Milliarden. Meine These ist, Es muss uns gelingen, 20 Prozent dieser Verwaltungskosten durch konsequente Digitalisierung, also Zusammenlegung von Leistungen, Aufbau einer Sozialplattform, Einsatz von KI und besserer Vernetzung einzusparen. Das wären bei den vorgenannten Beispielen mehr als sechs Milliarden Euro. Und noch ein letzter Punkt. Es kann nicht sein, dass wir nach immer mehr Personal rufen. auch ein übliches Ritual, anstatt die Produktivität der Verwaltung zu verbessern. Inzwischen geben wir nach Berechnung der AKDB, das ist die Datenzentrale in Bayern, 407 Milliarden Euro für Personal im öffentlichen Dienst in Deutschland aus. Und ein Prozent Digitalisierungsdividende von dieser Summe wäre mehr als vier Milliarden Euro. Damit könnten wir einiges machen. Hier müssen wir ran.Habbel:[4:36] Hier brauchen wir neue Ideen und neue Lösungen. Und damit sind wir schon mitten im Thema heute. Wir sprechen mit Arne Treves. Arne, kannst du dich kurz vorstellen? Ich denke auch, die Einführung brachte genau die Dinge auf den Tisch, die wir auch gleich dann noch mit dir diskutieren werden. Aber zunächst zu dir. Wer bist du?Treves:[4:55] Vielen Dank, Franz und Michael, dass ich hier bei euch sein darf und darüber diskutieren darf. Ihr habt ja genau die großen Themen angesprochen. Wer ich bin? Genau, ich bin Arne. Ich habe Re:Form hier bei projecttogether mit aufgebaut und mitgegründet. Das ist ja eine größere Allianz, vor allen Dingen von Verwaltungsmitarbeitenden, die wir probiert haben zu initiieren. Ich habe vorher lange Zeit bei den Vereinten Nationen gearbeitet und auch hier aber auch im Auswärtigen Amt, also kenne auch die Verwaltung auf der nationalen und supranationalen Ebene quasi von innen und war aber auch im Privatsektor, habe ganz früher mal The Voice of Germany mit aufgebaut und jetzt, bevor ich zu projecttogether gekommen bin, war ich in einer Beratung für den öffentlichen Sektor zuständig. Also habe da ganz viel auch mit Kommunen zusammengearbeitet und deren alltägliches Leiden und aber auch Tun und Wirken aus nächster Nähe miterleben dürfen.Lobeck:[5:56] Ja, ich hatte ja die Freude, dass ich dich auf der republica habe treffen können und du hast dort mit einer Kollegin einen Input gegeben zu dem, was ihr so macht. Wenn du das nochmal darstellen könntest, also was ist Re:Form und vielleicht auch nochmal kurz den Link, wie funktioniert das mit projecttogether, wie ist der Zusammenhang, was ist das eigentlich, dann können die Hörer:innen das gut einordnen.Treves:[6:23] Manche kennen projecttogether ja noch von „Wir versus Virus“ oder von Update Deutschland. Also worin wir, glaube ich, eine gewisse Expertise und auch irgendwie Wirkungskraft entwickelt haben, ist darin, dass wir größere Bewegungen aufbauen um Missionen herum. Also die unterschiedlichen Akteure über Sektoren hinweg zusammenzubringen und irgendwie ins Doing zu bekommen. Wir haben in diesen ganzen Missionen aber gemerkt, also wir haben die zu unterschiedlichen Themenbereichen gemacht – von Integration zu Kreislaufwirtschaft und anderen Themen, haben wir gemerkt, dass die staatlichen Akteure sowohl Ermöglicher als auch Verhinderer sein können. Also sie eine sehr zentrale Rolle darin spielen und dann dachten wir, okay, können wir doch mal unseren Ansatz, den wir haben und den wir relativ gut auch schon kennengelernt haben, so bei Update Deutschland, „Wir versus Virus“ im Zusammenspiel mit staatlichen Akteuren. Den können wir doch eigentlich auch gut mal wirklich reinbringen und haben dann eben so eine Allianz von Verwaltungsmitarbeitenden einfach angeschoben und gesagt, Was ist denn, wenn man nicht nur über die Verwaltung redet, sondern wenn man mal richtig reingeht und guckt, dass man hier die Hierarchie und föderale Ebenen übergreifend Leute zusammenbringt und sagt, wie sähe denn der Start von morgen aus und wie könnte man das in konkreten Experimenten auch jetzt schon zum Teil vormachen. Das ist eigentlich der Urkern oder der Urgedanke. Das haben wir vor zwei Jahren, fast genau zwei Jahren, losgetreten. Wir haben so alle sechs Monate, lädt uns eine Kommune ein zu einem Forum, in dem sich dann ein Teil der Community trifft, immer so um die 90 Leute auf Einladung einer Kommune, meistens zusammen sogar mit dem Land jetzt.Treves:[8:14] Und in der wir dann besprechen, was haben wir bis jetzt erreicht, wo haben wir eigentlich Experimente gut gestartet, was haben wir gelernt auf der einen Seite und was auf der anderen Seite muss aber nach vorne gehen. Und da haben wir auch zum Beispiel auch Inhalte entwickelt für den Koalitionsvertrag oder was wir glauben, was in den Koalitionsvertrag dann rein sollte, was wir dann noch probiert haben, so viel wie möglich mit zu übertragen und da zumindest einen gewissen Gehör gefunden haben, dann auch im Zusammenschluss und im Duett mit der Initiative für einen handlungsfähigen Staat.Habbel:[8:47] Du hast gerade den Begriff Verwaltungspioniere gebraucht und aber auch von Mitarbeitern gesprochen oder Mitarbeiterinnen. Was sind denn Pioniere in der Verwaltung?Treves:[8:59] Also es ist für uns ein loser Begriff, der aber auch die Wertschätzung ausdrücken soll für Personen. Also es wird ja gerade, wenn über Verwaltung gesprochen wird, von Außenstehenden, sagen wir mal, sucht man nach den positiven Spin oft in den Beschreibungen. Und wir gehen da mit einem anderen Ansatz ran, dass wir sagen, es gibt eigentlich jetzt schon in der Verwaltung sehr viele Personen, die probieren, Dinge neu zu gestalten, umzuändern. Gerade auf der kommunalen Ebene haben wir da auch jetzt wirklich die letzten zwei Jahre positive Erfahrungen gesammelt, dass es da unglaublich viele Leute gibt, die im System schon sehr viel anschieben und die wollten wir eben über die Grenzen hinweg zusammenbringen und damit denen auch so ein bisschen fast wie eine Heimat geben. Also manche fühlen sich dann ja auch öfter in ihren Ämtern, wo sie werkeln, alleine. Also dass auch, dass die Ideen schnell wandern zwischen den einzelnen Ebenen und aber auch zwischen Kommunen und so.Treves:[9:57] Das war genau der Ansatz irgendwie dessen. Und die VerwaltungspionierInnen sind eigentlich alle Personen, die in einer Verwaltung arbeiten und die Dinge konkret anpassen Also die probieren an dem Zustand, den wir jetzt gerade haben, nicht festzuhalten, sondern gucken, wie wir den eigentlich irgendwie verbessern und dort auch schon konkrete Dinge probiert haben zu lancieren. Ob erfolgreich oder nicht, ist dann erstmal egal, aber die eben diesen Energiedrang haben. Und das reicht vom verbeamteten Staatssekretär auf der Bundesebene bis zum Sachbearbeiter auf kommunaler Ebene.Habbel:[10:34] Man könnte es vielleicht auch so formulieren, das sind diejenigen, die ihre Komfortzone verlassen und Neues ausprobieren wollen und das in Gemeinschaft, unterschiedlicher Hierarchie-Ebenen zu dem Neuen finden wollen. Ist das so eine richtige Interpretation?Treves:[10:48] Ja, genau. Wir wollen damit auch zeigen und deswegen haben wir auch zum Beispiel so ein Newsletter aufgesetzt, in dem wir nicht Informationen über was passiert jetzt alles rausgeben, sondern dem immer welche aus der Community, also welche von diesen Verwaltungsmitarbeitenden mal beschreiben, was denn eigentlich ihre Idee ist und was sie eigentlich machen wollen. Wir wollen denen auch eine Bühne geben, um auch so ein bisschen dieses Narrativ zu brechen oder diese Geschichtserzählung, dass Verwaltung nur aus, sagen wir mal, stupide abarbeitenden RoboterInnen besteht, also die nicht richtig funktionieren. Das ist das Gefühl, das Bild, das manchmal draußen kolportiert wird und dem wollen wir entgegenwirken.Lobeck:[11:31] Das finde ich total großartig, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich mit Verwaltung zu tun habe, treffe ich einfach eigentlich viel häufiger, viel, viel häufiger Menschen, die was bewegen wollen und die was gestalten wollen, als ich jetzt Menschen treffe, die was verhindern wollen. Und manchmal können sie das da nicht, weil sie Strukturen hindern oder Rahmenbedingungen und so weiter und das finde ich ganz großartig, also beides, was ihr machen wollt, also denen eine Bühne zu bieten und das zu stärken und gleichzeitig gemeinsam dann zu gucken, wo können wir das denn verändern. Wie viele Leute sind das ungefähr? Also du sagtest gerade, alle sechs Monate kommen so roundabout 90 zusammen. Wie viele sind so ungefähr in diesem Netzwerk Und ist das, kann man sagen, da sind die Ebenen gleich verteilt oder gibt es einen Schwerpunkt bei den Kommunen oder ist es regional auch ganz unterschiedlich oder habt ihr, würde da sagen, ja gut, da gibt es auch Schwerpunkte historisch, wie auch immer. Also so, wer ist das?Treves:[12:29] Also angedockt in irgendwelchen Formaten bei uns haben mittlerweile schon 500. Also das sind nicht nur die, also unser Newsletter hat eine wesentlich größere Reichweite, aber die würde ich jetzt nicht dazu zählen. Also Leute, die sich auch bei uns an irgendeiner Stelle schon mal eingebracht haben. Ich würde jetzt mal runterdampfen, die, die wirklich an den Inhalten auch regelmäßig gearbeitet haben und schon mal bei Foren waren, sind wir jetzt bei 200. Also jetzt, wenn ich mal so die harten Re:Former sagen würde, sind es bei uns dann 200. Treves:[13:03] Natürlich gibt es aber auch da Abstufungen, also Leute, die sich wirklich sehr, sehr regelmäßig einbringen und welche, die dann irgendwie nur so alle drei Monate zu einem ganz gewissen Thema irgendwie arbeiten wollen. Genau, die Verteilung, da haben wir eigentlich von Anfang an probiert, darauf zu achten, dass wir zumindest die föderalen Ebenen gleich immer abgebildet haben. Wir haben immer mal wieder ein bisschen Schwerpunktverlagerungen gehabt. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr im Sommer und jetzt dieses Jahr im Februar, dadurch, dass die Neuwahlen anstanden, hatten wir dann durchaus auch einen gewissen Fokus auf die Bundesebene. Wir hatten aber trotzdem immer sehr starke kommunale VertreterInnen dabei. Jetzt das letzte Sommerforum In Göppingen, da war ein sehr starker Fokus auf die kommunale Ebene im Grunde genommen. Aber unser Ziel ist ja, die alle gleich mit reinzubringen. Wir haben eigentlich auch in der Verteilung der Bundesländer eigentlich eine gute Verteilung, fast ein bisschen mehr aus Ostdeutschland als aus Westdeutschland an manchen Stellen. Und der Süden, da würde ich mir fast noch mehr wünschen, dass wir da noch mehr Anschluss finden. Aber auch das, das wächst kontinuierlich.Habbel:[14:27] Und setzt ihr ja keine Regeln in den Debatten, die ihr führt. Auch aus der praktischen Ebene werden ja Vorschläge erarbeitet, Zusammenarbeit auch praktiziert. Wie kommen denn diese Erkenntnisse, die dort gewonnen werden, an die Regelgeber, also an die Politik, sei es auf Bundesebene, sei es auf Landesebene? Wir leben ja in einem föderalen Staat, wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten, manchmal auch zu komplizierte. Auch da müsste man natürlich in gewisser Weise ran. Also dieses Wissen von unten, sage ich jetzt mal ganz abstrakt, wie wird das transportiert in Entscheidungen? Oftmals habe ich das Gefühl, dass auch ein Realitätsverlust der Politiker-Ebene eingetreten ist. Was passiert eigentlich unten in den Verwaltungen konkret? und wie könnt ihr dagegen wirken, dass diese Realität auch, ich sage mal, bei der Politik ankommt und wie gesagt, wie können die Ideen, die ihr habt und die Vorstellungen dann auch wirken, um Regeln zu gestalten?Treves:[15:26] Genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, wie kriegt man diesen Übertrag hin? Also das Erste ist, dass wir in der Allianz oder im Re:Form immer probieren, so konstruktiv und konkret wie möglich zu arbeiten. Also entweder wirklich, indem wir Inhalte, wie es sein müsste, wirklich gemeinsam erarbeiten und schreiben auf der einen Seite oder manche auch das schon wirklich umsetzen.Treves:[15:51] Und dann haben wir aber auch gemerkt, okay, wenn wir jetzt nur uns, wir haben ja bewusst die politische Ebene rausgehalten am Anfang, weil wir so ein Safe Space auch kreieren wollten, in dem die Politik noch keine Rolle spielt, sondern Verwaltungsmitarbeiter unter sich wirklich sprechen und auch so ein bisschen darüber vielleicht auch noch meckern können, dass es dann immer an der politischen Glasdecke hängen bleibt.Treves:[16:11] Dann haben wir aber letzten Oktober angefangen, eine politische Allianz aufzubauen, also eine Gruppe von vor allen Dingen parlamentarischen Staatssekretären und Mitgliedern des Bundestages aus den Parteien FDP, SPD, CDU und Grüne, die sich im Sechs-Wochen-Rhythmus jetzt seitdem treffen und in die wir die ganzen Vorschläge immer reingegeben haben und die dort dann auch aber mit den Vorschlägen arbeiten mussten. Also da haben wir auch immer das Mantra rüber geschrieben, gemeinsam arbeiten statt gegeneinander debattieren, weil wir den Versuch wirklich gestartet haben, dass die Leute sich, also dass die politischen EntscheidungsträgerInnen sich wirklich konkret auch damit auseinandersetzen müssen. Also die mussten dann die Vorschläge, die aus unserer Community kamen, dann auch nach politischer Umsetzbarkeit irgendwie bewerten, einsortieren, dann gucken, wo würden sie vielleicht noch andere Dinge machen. Und da haben wir wirklich aktive Mitglieder auch mit dabei, also auf allen Seiten ehrlich gesagt gehabt, die das auch irgendwie mittreiben, sodass wir jetzt so eine Gruppe von 30 MdBs haben, die jetzt regelmäßig einfach sich damit auseinandersetzen. Das ändert sich natürlich immer nach Status und ihr wisst, wie viel in den letzten Monaten passiert ist.Treves:[17:31] Also am Anfang war es wirklich, okay, was müsste eigentlich in den Koalitionsvertrag rein und was sehen sie, was müsste dann in den ersten 100 Tagen passieren. Dann war auch so ein Fokus, dass dann natürlich auf das neue Bundesministerium geschwungen ist. So, was müsste eigentlich das Bundesministerium so machen? Also so, da gibt es immer wieder zu den Treffen natürlich eine gewisse Leitfrage und dann eben dieser Austauschraum, den wir probieren zu gestalten, bei dem wir auch immer dann zum Beispiel kommunale Vertreter aus unserem Netzwerk mit dazugezogen haben, die dann auch mal eben diesen Perspektivwechsel wagen. Genau, das ist eigentlich irgendwie der Versuch des Austausches darüber. Wir haben bei projecttogether noch eine andere Linie vielleicht, die nennen wir die Werkstatt der Mutigen, wo wir zu großen Werkstätten einladen, wo lokale Gestaltende, das sind meistens auch BürgermeisterInnen vor Ort, schon Dinge anders machen und konkret umsetzen. Und die matchen wir auch ganz bewusst mit MdBs dann am Ende und bringen die zusammen und da auch in den Austauschraum. Also genau das, was du sagst, dass da nicht eine Entrücktheit passiert, sondern dass sie wieder eher näher aneinanderrücken, ist auch ein Ziel von Re:Form.Lobeck:[18:50] Das finde ich total spannend. Was ich auch interessant fand, war eine sehr positive Beschreibung auf eurer Webseite. Da gibt es so acht Prinzipien, die ihr genannt habt. Das ist ja so, finde ich, es strahlt quasi geradezu. Ja, es ist so aufgeladen „von Effizienz zu Wirkung“, „von Verwaltung zu Gestaltung“, „von Herrschaft zu Augenhöhe“, „von Misstrauen zu Vertrauen“, „von Einzelmaßnahmen zu Missionen“, „von Planung zu Umsetzung“, „von Maschine zu Organismus“, „von Silos zu Allianzen“.Lobeck:[19:20] Was ich wirklich finde, was alles richtig klingt und es gut beschreibt. Ich hatte zwei Dinge, haben mich zögern lassen sozusagen, um mich direkt einzuschwingen, sage ich mal. Das eine ist, ich glaube ja schon, du hast vorhin das auch mal gesagt, es gibt eben natürlich auch Dinge, die sind zwar im öffentlichen Bild, so als sei das alles langweilig, aber es gibt ja auch langweilige Dinge in Verwaltung. Und ich denke dann immer an so was wie, ich hatte gerade einen Todesfall, an Standesämter, was man dann alles witzigerweise doch noch braucht. Die eine Geburtsurkunde und die eigene auch noch, weil ich, was weiß ich, ob ich da bin, ob ich schon geboren bin, das kann ja keiner wissen. Und die Sterbeurkunde und noch dieses und jenes und so weiter. Und das alles wird ja, das sind ja wirklich, würde ich jetzt erst mal sagen, relativ langweilige Dinge. Das wird alles registriert, das wird bearbeitet und das brauchen wir ja auch alles noch.
Und da wäre so meine erste Frage, wie kriege ich jetzt den Standesbeamten zu Augenhöhe, Gestaltung, Mission und so was, Ja, wenn er eigentlich sein Hauptjob ist, die Dinge vernünftig und richtig abzulegen und das auch im Zweifel dreimal zu kontrollieren, bevor da was falsch ist oder beim Katasteramt ähnlich. Also jetzt wahrscheinlich gibt es noch viele andere, wo es diesen Teil ja auch gibt. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ihr den verneint, aber darum nochmal die Frage, wie kommt ihr mit diesem Spannungsfeld zusammen? Wie geht ihr damit um?Treves:[20:49] Ich glaube, du sprichst es genau an, dass ein Spannungsfeld ist, auch ein Spannungsfeld bei uns dahingehend, dass wir sagen, wir wollen auf der einen Seite wirklich maximal ambitioniert sein und nicht nur über kleine Optimierungsrädchen sprechen, sondern wir müssen an manchen Stellen auch wirklich neue Vorstellungen aufbauen und auch neue Zielbilder aufbauen. Und das ist das, worüber wir gesprochen haben bei der republica, ist, dass wir ganz viel diesem New Public Management hinterhergerannt sind als so ein Leitparadigma, wo wir eben als ein sehr grundlegendes Maß gesagt haben, hier müsste man eigentlich ein neues Leitbild kreieren, weil der Staat eigentlich anders funktionieren müsste.
Also so ist es nicht mehr eine Maschine, unserer Meinung nach, die hermetisch abgeriegelt irgendwas als Service-Dienstleister kreiert, sondern eigentlich müsste der Staat und Kommunen, haben das lustigerweise früher, also in den 50er Jahren auch viel mehr noch gemacht, aber da müsste man hin, also wieder auch als gesellschaftsgestaltende Akteure in die Gesellschaft rein. So, natürlich, das ist jetzt maximal, da sagt dann jeder irgendwie, der jetzt gerade im Standesamt arbeitet oder in der Forstbehörde sagt, ja, schön gut, dass ihr mich jetzt irgendwie mit dem, aber was hat das jetzt mit mir zu tun?Treves:[22:05] Und das probieren wir dann schon auch immer runterzubrechen, was bedeutet das denn ganz genau? Also wenn wir zum Beispiel auf Augenhöhe sprechen, also über Augenhöhe statt, weiß nicht, Herrschaft sprechen, hat das eine natürlich mit einer Kommunikationsebene zu tun. Ich komme gleich zu deinem Beispiel auch, aber das andere auch, wenn wir zum Beispiel über Bürokratisierung oder Entbürokratisierung sprechen, dass wir in Deutschland gucken müssen, eher eben auf Pauschalen umzustellen oder dass wir Genehmigungstatbestände abbauen und eben Antrags- in Anzeigetatbestände umwandeln.
Also wenn ich jetzt in einem Wohngebiet mein Dachgeschoss ausbaue, dass ich dann nicht mehr drei Genehmigungen brauche und dass sich dann der Bearbeiter im Bauordnungsamt irgendwie damit auseinandersetzen muss, dass da drei Genehmigungen reinkommen und damit irgendwie dann am Ende wahrscheinlich vier, fünf Tage beschäftigt ist von einem Haus in einem ausgewiesenen Wohnbaugebiet, sondern dass ich das einfach nur noch anzeige. Der guckt einmal zehn Minuten drüber, ob da irgendwas irgendwie vielleicht unstimmig sein könnte und lässt es dann einfach geschehen und nach zwei Wochen ist das ganze Ding rechtssicher gegeben. Aber das bedeutet dadurch, jetzt an dem konkreten Fall, dass sowohl, ich glaube, auf der Verwaltungsseite extrem entschlackt wird und ich glaube da nicht nur an die 20 Prozent, Franz, sondern ich glaube da sogar an mehr. Also ich glaube, da ist mehr drin. Ich habe mal viele Prozesse erhoben für viele kommunale Verwaltungen. Da sind ja viele Wenn-Dann-Beziehungen drin. Also so, wenn das passiert, dann passiert das. Das sind schon Sachen, die kann man auch nach dem jetzigen technischen Stand gut durchautomatisieren.Treves:[23:39] Und ich glaube, ich hege noch den Optimismus, dass wir da auch wirklich irgendwo mal durchkommen. Also wenn irgendwo mal dieses Bottleneck der E-Akten-Einführung gebrochen ist und wenn sich da gewisse Konsolidierungs- und auch Zusammenfügungspunkte gegeben haben, dass wir nicht mehr 117-fach Verfahren in einer Kommune vorfinden, sondern dass sich da irgendwie so Sachen auch zusammenziehen. Und ich glaube, das wird in den nächsten fünf Jahren passieren, dann werden wir viel mehr als nur 20 Prozent in dem Backend-Durchlauf automatisiert durchlaufen haben. Da glaube ich wirklich dran. Und das bedeutet dann aber, dass die Person im Standesamt oder dass die dann eher, wenn ein Todesfall reinkommt, proaktiv auf die Leute zugehen und sagt, wie kann ich euch helfen?Treves:[24:23] Es tut mir wirklich leid, also mein herzliches Beileid, wir von der Kommune Elmsbüttel, wir trauern wirklich mit deiner Familie mit und hier, das ist übrigens mal eine Checkliste, das könntest du machen, hier können wir dir helfen. Also das wäre ja ein Anspruch, den man eigentlich hat, dass man in der Gesellschaft drin ist als staatliche Behörde und irgendwie da mehr moderieren kann. Das ist auch interessant, ich habe gerade über ein Beispiel gehört, dass Erdogan lustigerweise nur darüber, also in der Türkei, das muss man nicht als Paradebeispiel, aber es wird ja immer Estland und Dänemark genannt, die haben ein Ministerium, die sich nur darum kümmern, wenn eine bestimmte Zentrale, ein Todesfall oder ein Glücksfall in einer Familie passiert, dann ist das Ministerium dort mit einem Care-Paket. Und das finde ich schon, also natürlich will er da so eine Bindung haben zwischen der Partei und den BürgerInnen, aber ich finde, wenn wir das jetzt mal in unserer deutschen Sicht sehen, ich fände es schön, wenn der Staat so proaktiv wieder irgendwie auf die Menschen zugeht, weil eine gewisse Lebenslage ausgelöst wurde. Also dass ich mich, wenn ein Kind geboren wird, kriege ich einen Glückwunschschreiben und muss nicht eineinhalb Jahre das Kindergeld beantragen, sondern das ist automatisch sowieso passiert.Habbel:[25:37] Das führt uns ja zu einer anderen Aufgabenstellung auch der Verwaltung, was du gerade sagst, Arne. Und meine Antwort auf die Frage von Michael, was ist mit der langweiligen Arbeit, ist eben diese langweilige Arbeit zu substituieren durch KI beispielsweise, weil diese Dinge keine, ich sag mal, Ermessensentscheidungen beinhalten oder Abwägungsentscheidungen im weitesten Sinne und sich dann auf die, ich sag mal, wertschöpfenden Tätigkeiten auch kümmern. Wobei ich jetzt nicht den Standesbeamten damit abwerten möchte, denn die Aufgabe ist natürlich elementar auch notwendig und muss auch rechtssicher natürlich vonstatten gehen. Aber viele Bereiche lassen sich ja auch anders gestalten und automatisieren durch Bündelung, durch Zusammenfassung.Habbel:[26:20] Ich bin dir dankbar, dass du sagst, die 20 Prozent sind noch zu gering. Ich habe auch eine Zahl im Kopf, die ist weit höher. Die werde ich dann zur Gelegenheit mal auch belegen und auch darlegen, dass wir uns hier verändern müssen. Wir müssen auch hin in vielen Fällen zu einer antragslosen Verwaltung, wo einfach der Staat natürlich aufgrund von Once-Only-Datenbeständen weiß, wie bin ich, in welcher Situation gerade und wo kann mir wie wo geholfen werden. Deswegen auch gerade bei dem Thema jetzt Sozialreformen, darüber nachzudenken, solche Sozialplattformen zu etablieren, wo genau dieser Lebenslauf, den du gerade geschildert hast, auch mitläuft und dann entsprechende Dienste und Serviceleistungen in der Befähigung der Menschen, in der Stärkung der Menschen, in der Beratung der Menschen, in ihrer weiteren Entwicklung zu den Aufgaben eines kommunalen Umfeldes gehören in erster Linie und sich hier quasi neue Akzente setzen. Und daran zu arbeiten, insoweit, dass man die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der unteren Ebene, von der kommunalen Ebene, hier mal analysiert und fragt, wo liegen eigentlich die Knackpunkte und wo können wir helfen, glaube ich, das ist ganz wichtig, was Re:Form macht, wo ihr auch, glaube ich, eine Bedeutung habt, die weit über die üblichen Institute, die sehr speziell in einem bestimmten Segment Vorschläge machen, aber nicht den Gesamtzusammenhang einer neuen Verwaltung sehen.Treves:[27:45] Ja, total. Ich möchte nur eine Sache, weil oft gleitet diese Diskussion dann ganz stark und das merken wir auch am Bundesministerium in die reine Digitalisierung, also Verwaltungsdigitalisierungsecke ab. Und deswegen ist mir das schon wichtig nochmal zu sagen, damit kommt ein großer Kulturwandel oder wir müssen einen Kulturwandel wirklich auch sehr proaktiv angehen in der Verwaltung auf den unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, der kommt auch mit dem Generationswechsel, kommt der, glaube ich, sowieso.Treves:[28:16] Aber wir müssen es schon angehen, dass eben ein anderes Selbstverständnis da ist. Also auf den unterschiedlichen Ebenen. Und da herrscht an meiner Meinung nach irgendwie von außen manchmal ein Bild, ja, da will sich ja gar keiner ändern oder da will gar keiner irgendwie ein anderes Selbstverständnis haben. Und das in meinem Erleben, auch schon vorher in den ganzen Beratungsprojekten, war das überhaupt nicht der Fall.Treves:[28:38] Sondern natürlich ist es auch für viele SachbearbeiterInnen irgendwie lästig, wenn sie tausende von Genehmigungen, also damit überfordert sind, Genehmigungen zu prüfen, die dann am Ende sowieso irgendwie zu großen Teilen durchgehen und dann, sondern ich glaube, die wären auch mit einer reinen Qualitätssicherungsaufgabe irgendwie zufrieden, dass sie Qualität sichern, was jetzt da aus der KI rauskommt und gucken und dann aber viel mehr auch in der Kommunikation und Gespräch sind. Aber dazu brauchen sie auch Hilfe, also sie müssen auch eine andere Ausbildung oder Weiterbildung, also gerade Kommunikationsfähigkeiten sind dann wirklich Dinge, die stark einfach auch mittransportiert werden müssen und nicht nur über, also ich meine, ich bin selber Jurist, deswegen aber nicht nur durch Juristen und Verwaltungsdiplome, irgendwie abgedeckt werden oder wir müssen da einfach eben Gestaltung muss mit in das Kompetenzportfolio mit rein, Kommunikation muss mit ins Kompetenzportfolio mit rein, auch Mediation muss mehr rein, weil wir dann auch Dinge, also gesellschaftliche Konflikte viel stärker auch auf der kommunalen Ebene schon irgendwie moderativ vielleicht abfangen können oder auch eben umwandeln können in jetzt mal positive Energie im Grunde und Gestaltungskraft.Treves:[29:54] Aber dafür müssen wir auch an die Ausbildung ran, dafür müssen wir auch an Prozesse und Strukturen ran und nicht nur Verwaltung digitalisieren. Ich glaube, also das ist ein Riesenbatzen und das müssen wir auf jeden Fall tun.Treves:[30:06] Aber ich würde davor warnen, zu sagen, jetzt digitalisieren wir alles und vergessen aber den ganzen Punkt von Mensch an der Sache und die ganzen Ressourcen, die wir wirklich haben. Also ich weiß nicht immer, welcher Statistik man da glauben soll, aber wie viele Leute im öffentlichen Dienst arbeiten. Ich habe so eine Zahl von 6,2 Millionen im Kopf, die ich glaube ich beim Statistischen Bundesamt gelesen habe. Da sind LehrerInnen und so mit dabei. Wir haben eine Riesenprozentzahl von unserem Arbeitsmarkt, arbeitet im öffentlichen Sektor.Habbel:[30:42] Vielleicht wäre es ja schlauer gewesen, das neue Ministerium so zu nennen, Ministerium für Staatsmodernisierung und Digitalisierung, statt umgekehrt für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.Treves:[30:53] Das ist auch unser Vorschlag immer gewesen. Wir sind schon mal froh gewesen, dass das Staatsmodernisierung mit drin ist im Titel. Das war ja durchaus auch überraschend dann am Ende, aber darüber haben wir uns gefreut.Lobeck:[31:07] Ich fände noch eine Sache, die, Ihr habt an irgendeiner Stelle, ich muss gerade überlegen, wo, ich gucke mal kurz auf meinen Zettel hier, bei der Erläuterung von eurem Thema von Maschine zu Organismus kommt der Begriff systemisches Denken vor. Und als jemand, der mal eine Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler gemacht hat, habe ich immer auch den Blick, das bestehende System hat ja Vorteile, sonst hätten wir es schon lange nicht mehr. Ja, und so ein bisschen zu gucken, wo, also was ist das, wie kriegt man das mit, was es im Moment, welche Interessen auch immer es bedient, ja, ich bin da jetzt nicht im Detail, kann ich da gar nicht zu sprechen, vielleicht habt ihr da schon noch eine Idee, also warum ist es so, wie es ist, also wer profitiert da eigentlich jetzt von, also wer sind, nicht unbedingt einzelne Personen, aber was führt dazu, dass wir das so machen, wie wir das machen, wo wir doch eigentlich alle, wenn wir da drauf gucken, denken, das ist ja irgendwie unbefriedigend. Und wenn es da legitime Interessen gibt, die jetzt durch dieses System hervorgebracht werden, wie kriegt man die bei dem Wandel mitgenommen? Weil das ist ja immer so die Frage, man will ja nicht immer alles zerschlagen, also wir hatten gerade das Standesamt, das soll es nachher weiter noch geben, ja, wir machen jetzt nicht nur alle irgendwelche tollen Missionen, wo wir sagen, oh, das ist ein tolles Thema, das machen wir jetzt und die Basics machen wir nicht mehr. Aber hast du da noch eine Idee oder ist das einfach jetzt ein zu akademischer Gedanke quasi?Treves:[32:36] Nee, total. Ich bin auch ausgebildet als systemischer Organisationsberater. Also deswegen kann ich da gut mitgehen. Ich glaube, es gibt mehrere Grundgedanken. Das eine ist, genau deswegen haben wir Re:Form als eine Allianz von Verwaltungspionieren gegründet. Also, dass Leute sind, die from within, also aus dem System heraus Dinge erarbeiten. Wir haben dann aber gesagt, wir müssen denen aber irgendwie einen Platz außerhalb des Systems geben, weil wir sind ja eine gemeinnützige Organisation, die nicht im System mitspielt. Denen müssen wir einen Platz geben und die müssen wir dann aber auch so ein bisschen anheizen, dazu mutiger zu denken, damit sie, wenn sie ins System wieder zurückkommen, nach so einem Forum oder nach den Arbeiten, die sie mit uns machen, irgendwie dann sagen, okay, jetzt hier können wir ja wirklich anders machen.Treves:[33:32] Und eine zum Beispiel eine Systemlogik, die wir haben, ist eben dieser starke Kontroll-, also Kontrollwahn, das sage ich, da ist schon eine Bewertung mit drin, aber also der starke Drang zur Einzelfallgerechtigkeit. So ist, glaube ich, ein bisschen abgeschwächter formuliert, dass wir den einfach auch aufgeben müssen. Und der steht nirgendwo kodifiziert. Also so vieles im System, wie es gerade funktioniert, ist eigentlich nirgendwo festgehalten und das ist eher eine kulturelle, traditionelle Sache, die sich eingeübt hat. Aber man muss natürlich sehen, woher kommt es eigentlich, also woher kommt es, dass wir so einen starken Drang zur Einzelfallgerechtigkeit haben im Gegensatz zu anderen Kulturräumen. Also da sind in Skandinavien oder auch in anglosächsischen Bereichen ist es wesentlich weniger.Treves:[34:18] Und das wirklich mitnehmen und sagen, wir haben da ein Kontrollbedürfnis anscheinend im deutschen Kulturraum, dem müssen wir irgendwie gerecht werden trotzdem. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite kontrollieren wir uns aber gerade tot und dann führt es eher zum Gegenteil, nämlich wenn wir zu viele Regeln und Kontrollinstanzen aufbauen, haben wir die Kapazitäten dafür nicht und alle sagen, okay, ich weiß ja sowieso gar nicht mehr, an was ich mich hier halten soll, dann halte ich mich an gar nichts.Treves:[34:45] Und ich glaube, so kommen wir dann dazu, dass wir sagen können, zum Beispiel Anzeigetatbestand. Also wenn du nicht mehr eine Genehmigung für deinen Dachausbau brauchst, sondern wenn du sagst, okay, du musst es anzeigen und die Behörde hat dafür drei Wochen Zeit, dann haben wir irgendwie noch so ein bisschen die Ruhe. Ja, im Bauordnungsamt guckt da jemand drüber und führt das durch. Aber wir haben auch eine Entschlackung, weil wir wissen irgendwie, das muss nämlich nicht mehr alles wirklich von fünf Leuten kontrolliert und gegengezeichnet werden. Das ist das eine.
Das andere jetzt auf einer größeren Ebene, glaube ich, haben wir im System, also wir haben im Grunde genommen die Selbstbestimmung der Kommunen erfunden. Also das ist in Deutschland. Und da kommen wir her, preußische Re:Form, dass die Gemeinden eine sehr, sehr starke Rolle gespielt haben und dann eine obere nationale Instanz, das irgendwie zusammenhält in einem nationalen Rahmen. So, ich finde, das ist eigentlich ein, also jetzt nicht das Kaiserreich, da will ich jetzt nicht falsch verstanden werden, aber ich finde, das ist eigentlich, das ist ja fast schon wieder ein modernes Leitbild von Organisationen, dass wir sagen, guck mal, da kommen wir her, eigentlich müssten wir die Kommunen wieder viel, viel mehr stärken und ihnen diesen Freiraum geben, wieder selbst gestalten, vor Ort tätig zu sein, indem wir ihnen aber trotzdem als zentral gewisse, also einfach viele Dinge auch abnehmen und als Servicedienstleistung zur Verfügung stellen. Also, ihr wisst, da spiele ich jetzt auf.Habbel:[36:13] Wenn ich dich mal unterbreche, spreche ich ja von dezentraler Zentralität.Treves:[36:18] Genau, sehr gut.Habbel:[36:19] Also, diese beiden Dinge zusammenzubringen, könnte wahrscheinlich der neue Entwurf sein, daraus noch mehr Nutzen zu ziehen, die Vertrauenskultur insgesamt auch wieder zu stärken. Das ist ja auch ein Thema, was du gerade sagst. Vertrauen wir dem Staat noch oder haben wir da auch Probleme, dass wir da auch uns wirklich ehrlich machen müssen? Und entsprechende neue Formen brauchen, wie kann auf der dezentralen Ebene Eigenverantwortung und Gemeinschaft entstehen, gleichzeitig aber auch dezentrale Service-Elemente damit eingebunden werden, die quasi verhindern, dass 11.000 Mal, 11.000 Mal das Gleiche in der Administration, nicht in der Politik, in der Administration gemacht wird. Deswegen bringt mich das, weil wir uns auch ein bisschen auf die Zeit hier einstimmen müssen zu der Frage nochmal. Ihr habt mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ja ein Projekt gestartet, ein Siegel „Bewährt vor Ort“. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen, Arne, und auch nochmal dann in dem Zusammenhang aufgreifen, wie eigentlich so die Gedanken, die ja schon seit 30 Jahren existieren, eine Datenbank aufzubauen guter Lösungen, inwieweit das eine Rolle spielen kann in Deutschland oder ob wir da auch nicht wieder Friedhöfe bauen, die dann irgendwo wieder nicht das bringen, was man erwartet. Also zunächst mal zu der Frage des Projektes „Bewährt vor Ort“.Treves:[37:43] Super gerne und vielleicht nur Michael als Abschluss, nämlich dessen, weil ich sage, es ist, oder Franz, weil du gerade gesagt hast, ein Neuentwurf, für mich ist es nämlich gar kein Neuentwurf, es ist fast so ein bisschen back to the roots, nur aufgeladen mit besseren technischen Möglichkeiten. Also wenn wir sagen, die Kommunen haben viel mehr wieder Freiraum vor Ort gestalten zu können, dann früher konnte das Kaiserreich dann nicht irgendwie nachgucken, was jetzt eigentlich in Göppingen passiert ist und was eigentlich in Kiel passiert ist. Jetzt haben wir die technischen Möglichkeiten, eine sehr schnelle Kommunikationslinie herzustellen zwischen Göppingen und Kiel, wenn Kiel etwas erfunden hat, was Göppingen auch helfen könnte.
Und da kommen wir zu „Bewährt vor Ort“, weil wir gesagt haben, eigentlich ist es doch der perfekte Rahmen. Wir haben 11.000 Kommunen, also haben wir eigentlich 11.000 Sandboxes, in denen Sachen ausprobiert werden können. Wir müssen jetzt aber irgendwie schaffen, dass es schneller wandert, dass die Ideen schneller wandern. Also sie brauchen eine gewisse Öffentlichkeit und auch so ein bisschen so ein Siegel quasi. Ey, das hat schon mal geklappt. Und das haben sich auch noch mal ein paar ExpertInnen angeguckt. Die glauben da dran. Und daraus ist „Bewährt vor Ort“ entstanden, dass wir gesehen haben, okay, lass uns einfach mal rausrufen, wer hat denn Lösungen, die er oder sie schon bei sich vor Ort angeboten haben und die dann auch wirklich funktioniert haben.Treves:[39:09] Und dann geben wir denen eine gewisse Öffentlichkeit. Das ist quasi der Grundgedanke dahinter. Dann kam der zweite Gedanke natürlich, okay, nur rein eine Preisverleihung oder eine Siegelvergabe zu machen und irgendwie öffentlich zu machen, reicht nicht aus, sondern wir müssen eigentlich auch so den Prozessschritt dahinter stärker machen. Also es bräuchte eigentlich so was wie Lösungslotsen in Regionen, auf die die Kommunen zugehen können und so ein bisschen sagen können, Hey, ich habe hier folgendes Problem. Gibt es dazu was und dann kennen die Lösungslotsen das und das technische Pendant der Lösung ist dazu natürlich so ein Marktplatz der Lösungen oder also der, wie du ja richtig sagst, schon seit 30 Jahren in den unterschiedlichsten Formen schon immer irgendwie angedacht und auch viel umgesetzt worden, deswegen haben wir jetzt, gefühlt sieben oder acht Parkplätze äh, Parkplätze, auch Marktplätze, die auch zum Teil nur Parkplätze sind für Ideen, ähm.Treves:[40:05] Und unsere Vorstellungen daran sind ja auch in den Diskussionen mit FITKO und anderen, dass wir irgendwie gucken, dass eigentlich dazu eine Lösung, also dass wir wirklich diese Datenbank, eine zentralisierte Datenbank aufbauen, wo nicht nur digitale Lösungen, sondern auch andere Lösungen, die im kommunalen Rahmen schon mal funktioniert haben, einfach dargestellt werden und so aufbereitet sind, dass sie gecopy-pasted werden können. Also dass, wenn jetzt Erlangen etwas von Essen übernehmen will, dass sie den Stadtratsbeschluss quasi nicht neu schreiben müssen, sondern dass sie im Grunde genommen einfach nur austauschen, Erlangen, Essen, ersetzen, das kann man in Word, also Microsoft gut machen.Treves:[40:45] So was. Oder dass auch allein so, wie oft wird eine Planung ausgeschrieben für, weiß nicht, jetzt zum Beispiel eine klimaneutrale Schulgebäude oder irgendwie so was, gefühlt macht das jetzt gerade jede Kommune, wenn man da aber irgendwie zentral abrufbar, hier übrigens klimaneutral mit folgenden Kriterien ausgeschriebene Planungsentwurf, so kann übernommen werden, haben wir eingekauft, haben wir die Rechte zu und dann übernimmt eben, können das irgendwie 500 andere Kommunen einfach für sich übernehmen. Die glauben, dass irgendwie dieser Entwurf bei ihnen eigentlich auch ganz gut passt, weil man ein freies Feld hat. So, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Möglichkeit. Man muss diesen zentralen Raum schaffen. Ich glaube, das ist jetzt eher eine Sache, wo ich ehrlich gesagt das Ministerium durchaus auch in einer Rolle sehe, das zusammenzuziehen. Aber wir sehen uns dann da auch irgendwie so ein bisschen als Wadenbeißer, zu sagen, so, ey, hier, lass uns mal diese ganzen Marktplätze der Lösungen zu einem zentralen zusammenführen und nicht nur in Digitalisierung denken, sondern auch andere Aspekte denken.Habbel:[41:46] Vielen Dank, Arne. Die Zeit ist over, ist über. Michael, du hast das letzte Wort.Lobeck:[41:52] Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, Arne. Ich fand das einen sehr schönen Einblick. Ich finde wirklich euer Anliegen, neue Sichtweisen reinzubringen, die Haltung zu verändern und einfach zu gucken, wo kann man hier gestalten. Also positiv finde ich sehr schön. Und ich kann nur alle VerwaltungsmitarbeiterInnen, die uns hören, ermutigen, sich auf diese Seite einmal anzuschauen und sich damit einzuklinken und einzubringen und sich sowohl Inspirationen zu holen, als auch welche zu geben. Und ansonsten wünsche ich allen anderen Hörerinnen und Hörern, wenn Sie noch Themen haben, die wir auch mal behandeln sollten, schicken Sie uns eine E-Mail an info@habbelundlobeck.de, die erreicht uns beide und wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen restlichen Sommer.
Das Transkript wurde automatisch mit Auphonic unter Nutzung von Whisper ASR (Open AI) erstellt und ca. eine Stunde nachbearbeitet.