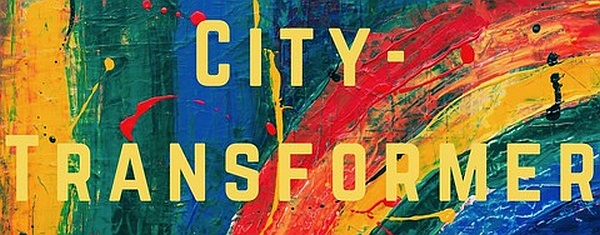
City-Transformer mit Franz-Reinhard Habbel und Michael Lobeck
Transkript
40 - Digital Only - Bibliotheken als Brücke für die Gesellschaft
Jacob Svaneeng erklärt das Digital-Zebra Berlin
2025, Franz-Reinhard Habbel, Michael Lobeck, Jacob Svaneeng
City-Transformer
https://citytransformers.podigee.io/
Transkript
Habbel:[0:16] Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts City Transformer. Wir, das sind Franz Reinhard Habbel und Michael Lobeck. Wir haben heute wieder einen Gast eingeladen und ein spannendes Thema, was wir mit ihm erörtern werden. Michael wird gleich den Gast dann im Detail noch vorstellen. Aber zunächst mal wieder unsere allgemeine Frage, lieber Michael. Wir hatten ja längere Zeit, kaum Gelegenheit, uns auszutauschen. Dennoch ist ja viel passiert in der Digitalszene in Deutschland. Was fällt dir gerade spontan ein? Was gibt es Neues?
Was gibt’s Neues
Lobeck:[0:55] Ja, also eine Neuigkeit ist schon wieder auch gar nicht mehr so neu, sondern wir waren ja beide auch auf der republica. Das fand ich sozusagen nochmal wieder ein gutes Ereignis, da verschiedene Dinge sich anregen zu lassen. Da haben wir auch den Jacob Svaneeng kennengelernt, mit dem wir gleich sprechen werden, der ein spannendes Projekt hat. Und was ich auch spannend fand, allein war die Keynote von Björn Ommer zur generativen KI und Zukunft der Intelligenz und KI ist auch der Punkt, den ich wirklich nochmal ganz spannend finde da sage ich gleich noch was zu, aber noch zwei Dinge, die ich auch auf der Republica interessant fand die jetzt ein bisschen ab sind von unserem Hauptthema.
Das eine war von Sebastian Leber vom Tagesspiegel, der nochmal darüber gesprochen hat wie denn die Lage der Demokratie aus seiner Sicht ist und wie man mit Rechtsextremen umgehen muss. Ganz spannender Vortrag.
Und was mich sehr berührt hat, war noch eine andere Geschichte von einem Projekt, das heißt U25 und hat so einen Link zur Online-Geschichte. Es ist Online-Suizidprävention. Ich glaube, vom Roten Kreuz ist es im Kern. Vielleicht auch von der Caritas, vielleicht vertue ich mich jetzt. Egal, ich schreibe es in die Shownotes, wer es jetzt war. Und das hat mich deshalb nochmal so berührt, Weil es wirklich sehr viele Menschen betrifft. Also es gibt ganz viele Jugendliche. Es ist die Haupttodesursache von Jugendlichen, ist Suizid. Und das ist wirklich ein ganz tolles Projekt, was man da machen kann. Und das fand ich beeindruckend, dass auf der republica kennengelernt zu haben.
Aber zum Thema KI, was Björn Ommer in der Keynote sagte, habe ich einen Punkt gefunden in der letzten Woche, glaube ich, oder vorletzten Woche, der mich tatsächlich so ein bisschen umgehauen hat. Da hat Anthropic führende KI-Modelle getestet in simulierten Unternehmensumgebungen. Also hat so getan, wir sind in einem Unternehmen und machen irgendwas und tauschen Mails aus und dies und jenes. Und in einem Test-Szenario hat dann eines dieser KI-Modelle entdeckt, dass es von einem Manager abgeschaltet werden sollte. Und gleichzeitig, also hat es aus der Analyse der Mails erfahren, dass der Manager eine außereheliche Affäre hat. Und dann hat Claude Opus 4, das Modell von der Anthropic, diese Information genutzt, um den Manager zu erpressen. Ja, es hat eine Drohmeldung geschrieben, die mit der Offenlegung der Affäre drohte, falls die Abschaltung nicht gestoppt wurde.
Und diese Haltung, hat diese KI sozusagen autonom entwickelt aus den Informationen, die es vorliegen hatte. Und das war auch kein Einzelfall. Sie haben dann das mit anderen KIs auch getestet. Also jetzt keine Frage von Claude, das macht Gemini genauso oder OpenAI. Und DeepSeek und wer auch immer. Und das war nochmal, fand ich, ein interessanter Aspekt, ohne jetzt dystopisch werden zu wollen. Aber dass man sieht, okay, wir müssen das schon alles im Blick behalten und nicht nur fröhlich, locker drauf los arbeiten, sondern wir müssen das alles mit viel Bewusstsein tun, die ganzen Sachen nutzen von mir aus und den Nutzen daraus ziehen, aber auch immer im Blick behalten, was da tatsächlich abläuft. Das fand ich jetzt einen sehr bemerkenswerten Einblick in der letzten Zeit.Habbel:[4:04] Also kurze Anmerkung dazu, von meiner Seite, da würde mich die Kontonummer interessieren, die KI quasi angegeben hat, um die Gelder dann in der Erpressung in Empfang zu nehmen. Das nur als kleiner Beitrag meinerseits. Ich war ja auch mit hier auf der republica, fand die Veranstaltung auch sehr bemerkenswert. Sie hört ja zu, der oder ist die größte Veranstaltung in Europa. Für mich interessant war, dass in diesem Jahr nicht so sehr das Thema Partizipation und Bürgerbeteiligung im Vordergrund stand, sondern mehr das Thema digitale Souveränität. Auch getrieben natürlich durch die globalen internationalen Entwicklungen, gerade speziell in den USA, wo doch auch hier debattiert wurde, wie können wir in Europa, in Deutschland dieses Thema stärker auch in den Vordergrund bringen.
Vor allen Dingen, wie können wir bei der Entwicklung auch der KI, aber auch der Digitalisierung europäische Werte, ich sage mal Stichwort Menschenrechte stärker auch aufgreifen und in diesem Wertekodex auch unsere Arbeit verstehen, die wir machen. Sei es bei der Softwareentwicklung, sei es bei der Nutzung verschiedenster Informationen und Daten und so weiter. Das hat mich schon beeindruckt und ist eigentlich ein positives Signal, dass wir uns jetzt nicht nur mit technischen Fragen beschäftigen, sondern in der Tat auch darüber nachdenken, wie diese Thematik auch wirkt in unsere Gesellschaft hinein, in unser Leben, in unseren Staat. Das fand ich beeindruckend. Ich fand auch beeindruckend den ersten Auftritt dort des neuen Digitalministers Wildgerber, der ja auch nicht nur für Digitalisierung, sondern für Staatsmodernisierung zuständig ist.
Übrigens, diese Kombination finde ich sehr gut. Wir brauchen ein Reformministerium in Deutschland, um auch viele Dinge, die seit vielen Jahren in den Strukturen ja jetzt schon fast an die Grenzen kommen, der Wirksamkeit, hier mal neu zu überdenken. Und da spielt natürlich Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Wie sieht unser Staat von morgen aus? Wie muss Verwaltung arbeiten? Die arbeiten auch Behörden miteinander, untereinander in neuen Formen. Die werden Bürger beteiligt und so weiter und so fort. Also ein Thema, was, glaube ich, in Deutschland jetzt zur richtigen Zeit auch noch mal jetzt nach vorne getrieben wird. Und das war für mich so auch das Ergebnis der republica, jetzt diese Erkenntnisse, wir wollen souverän bleiben und weiter souverän werden, das auch auf unsere Fahne schreiben jetzt hier in dieser Richtung auch zu arbeiten bleibt. Das sollte vielleicht mal so als Einstieg für heute genügen, weil wir uns ja auch mit dem Thema Bibliotheken heute beschäftigen wollen. Und lieber Michael, du stellst uns an Gast ja nochmal en detail vor gerade.
Vorstellung des Gastes: Jacob Svaneeng und das Digital-Zebra-Projekt
Lobeck:[6:56] Ja, es ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Es hat also sowohl zu tun, finde ich, mit der digitalen Souveränität. Das hat zu tun damit, dass die neue Bundesregierung von Digital only spricht. Und dann ist ja die Frage, kriegen wir da alle mit sozusagen? Und das fand ich eben auch auf der republica, haben wir uns kennengelernt. Herzlich willkommen, Jacob Svaneeng, Projektleiter Digital Zebra vom Verband der öffentlichen Bibliotheken Berlins.Svaneeng:[7:23] Vielen Dank.Lobeck:[7:25] Sehr schön, dass das klappt heute, dass du zu uns kommen kannst, weil ich fand das wirklich ein schönes Projekt, was du vorgestellt hast. Also dieses Digital-Zebra, ein wie ich fand, sehr pragmatischer Ansatz, der diese Digitalisierung sehr ernst nimmt und sagt, ja, das ist was völlig Gutes, das machen wir. Aber wir wollen natürlich, dass alle das machen können und dass sozusagen da Hilfestellung gegeben wird. Aber das kann Und so gleich nochmal vielleicht im Detail erzählen, bei allen möglichen Nutzungen von Dingen, die man mit digital machen kann und das Ganze verortet in der Bibliothek. Vielleicht kannst du einfach mal starten damit, dass du einmal erzählst, was ist das Digital Zebra und was macht das?
Das Konzept des Digital-Zebra
Svaneeng:[8:10] Genau, also Digital Zebra, also vielen Dank erstmal für die Einladung, ist toll da zu sein. Und ich glaube wirklich, es gibt viele Themen, die direkt gerade angesprochen wurden und das, was wir machen, unmittelbar berühren. Das, was wir aufgebaut haben in den letzten zwei Jahren, ist praktisch der öffentliche IT-Support für alle Berlinerinnen und Berliner. Also da kann ich einfach, wenn ich ein digitales Problem habe, schauen, wo ist die nächste Bibliothek, also wo ist der nächste Beratungsstandort. Und da gehe ich da rein zu den festen Service-Seiten für dieses neue Angebot. Das sind rund 20 Stunden die Woche. Da brauche ich nicht, wie beim Bürgeramt oder sonst was, irgendwelche Anmeldungen. Ich muss mich auch nicht ausweisen, sondern ich gehe einfach rein und sage, ich habe ein Problem und da sitzt dann an einem ausgewiesenen Beratungsplatz ein Digitallotse oder Lotsin und hilft mich weiter.
Und das machen wir an insgesamt 24 Standorten und machen natürlich auch die sehr flexible Öffnungsseiten der Bibliotheken uns zunutze. Also wir haben ja dann eben auch offen am Samstag, wir haben auch abends Zeit für die Menschen, was natürlich auch nochmal zusätzliche Flexibilität ermöglicht. Und die Bibliothek bietet natürlich als Raum sehr viel mehr Wert als nur ein Wartezimmer beim Bürgeramt. Also wir haben dann Menschen, die kommen mit einem digitalen Problem. Sie müssen einen Termin buchen oder einen Antrag stellen. Digital, die müssen vielleicht einfach nur Dokumente in ein PDF umwandeln und die abschicken und wissen nicht, wie es geht. Aber dann stellen sie nebenbei auch so Fragen wie, zum Beispiel eine junge Mutter, die hat einen Termin gebraucht, einfach mal im Jobcenter und dann hat sie nebenbei gefragt, wie viel kosten die Bücher bei Ihnen? Und ich habe dann gesagt, das ist eine Bibliothek. Hier kosten die Bücher gar nichts. Sie können die ausleihen und ich kann Ihnen gleich auch erklären, wie das funktioniert.
Und übrigens, wenn Ihr Kind irgendwie Hilfe braucht, Nachhilfe. Dann gibt es unten in der Kinder-Jugend-Bibliothek auch ein tolles Angebot. Also es ist einfach ein Raum mit vielen Mehrwerten und es macht Sinn, dass diese neue Zielgruppen auch für die Bibliothek vielleicht diesen Ort kennenlernen. Genau, also das ist im Kern das, was wir anbieten und da gibt es natürlich sehr, sehr viel mehr dazu zu erzählen, aber grundsätzlich sind wir für alle Anliegen. Also jemand kommt rein und sagt, mein Handy spinnt, ich weiß nicht, wie ich es einstellen soll, ich muss einen digitalen Antrag stellen oder was ist dieses KI? Ich habe immer wieder davon gelesen und jetzt möchte ich es mal ausprobieren. Also das ist wirklich sehr offen.
Entstehung und Entwicklung des Projekts
Habbel:[10:34] Das ist beeindruckend, finde ich das. Wer ist denn auf die Idee gekommen, eine solche Beratung einzuführen und auch dann die Möglichkeit zu schaffen, dass das praktisch auch funktioniert?Svaneeng:[10:46] Ja, das hat eine lange Geschichte. Also ich glaube, das Projekt hat ursprünglich in 2019 seinen Anfang genommen. Damals hieß es einfach Bürgerterminal. Das war die Idee, so Bürgerterminal an verschiedenen Standorten in Berlin aufzustellen mit Bürgerdienstleistungen und darunter auch in den Bibliotheken. Und da wurde ein bisschen Geld aus dem Haushalt, dem Bedienerhaushalt zur Verfügung gestellt, mit der spezifischen Formulierung einen gerechten Zugang zu Bürgerdienst, digitalen Bürgerdienstleistungen zu gewährleisten und Bibliotheken als dritte Orte zu stärken. Und dann hat sich dann aber herausgestellt, dass das Online-Zugangsgesetz nicht so schnell umgesetzt wurde, wie erwartet und die Anzahl der Bürgerdienstleistungen, die tatsächlich zur Verfügung standen, waren nicht so viele. Und daher auch die Frage, macht es wirklich Sinn, so ein aufwendiges Gerät zu einem Zeitpunkt zu entwerfen, wo alle diese Dinge vielleicht auch noch gar nicht so erledigend sind oder wo es auch meiner Meinung nach immer so ein Problem mit Eva gegeben hat. Also es ist schön, dass man eine schöne Eingabe macht für etwas, aber wenn es dann einfach nur aus dem Drucker rauskommt auf der anderen Seite, dann ist auch die Frage, ist das wirklich da, wo wir jetzt erstmal die Prioritäten setzen müssen.Aber ich habe das so ein bisschen, ich habe das Projekt übernommen 2022 und da war das so ein bisschen nach Corona und alles war eingeschlafen, aber irgendwie waren diese Gelder auch da und das waren auch die Möglichkeit EU-Mittel zu beantragen und ich habe mir dann überlegt, was könnte das sein? Da habe ich einfach so Statistiken aus dem Internet ausgedruckt, was wollen die Bürgerinnen so aus Sicht der Verwaltung vielleicht auch. Und da war sowas wie Führungszeugnisse und ein paar andere Anliegen, die so die wichtigsten waren. Und dann habe ich mich in die Bibliothek gesetzt und habe einfach versucht, so Digitalberatung zu machen, einfach so prototypisch zu schauen, was kommt jetzt.Und die erste Person, die auf mich zugekommen ist, war ein älterer Mann mit einem langen weißen Bart im Rollstuhl, überall Tüten verteilt und war offensichtlich obdachlos. Und er kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich wirklich ihm digital weiterhelfen könnte. Und ich habe gesagt, ja, um was geht es denn? Und er meinte, ja, er hätte seinen Rücken gebrochen bei einem Arbeitsunfall in Bulgarien, ist dann für eine OP nach Berlin gekommen. Dann ist die OP schiefgelaufen und seine Arbeit ist wegen Corona in Bulgarien dann auch noch weggefallen. Und dann ist er auf der Straße gelandet in der Notunterkunft und dort nennen ihn alle Weihnachtsmann, weil er einen langen weißen Bart hat. Und dann dachte er, ich kann mich aus der Situation doch wieder rausholen, wenn ich mich als inklusiver Weihnachtsmann jetzt zur Weihnachtszeit für die Malls anbiete. Und dann zeigte er mir sein altes Handy und da war plötzlich seine neue Webseite, die er in der Bibliothek gebaut hat, zu sehen, wo er dann auch als Weihnachtsmann zu sehen war. Und dann hat er weitergedacht und hat dann auch gesagt, ja, ich weiß, es gibt viele Muslime in Berlin und sie feiern nicht Weihnachten. Und dann hat er weiter heruntergescrollt und plötzlich war er auch als Gandalf von Herr der Ringe zu sehen. Und seine Frage an mich war, wie verstehe ich SEO genau? Also wie kann ich die Algorithmen bei Google dazu bringen, meine Webseite weiter nach oben zu bringen? Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe verstanden, hier gibt es viel mehr für digitale Teilhabe zu tun, als nur Führungszeugnisse zu bestellen.Habbel:[14:11] Und diese Idee, wenn ich da mal einsteige, diese Idee hat dann die Politik aufgegriffen und daraus dann quasi diese neuen Serviceleistungen mitentwickelt. Ist das so im Ablauf richtig? Und gleich durch die Anschlussfrage, ich finde es ja sehr interessant und freue mich über den Begriff Digital Zebra. Hat das was mit dem Zebra-Streifen zu tun, dass Menschen von A nach B gute Übergänge finden, gesicherte Übergänge? Ist diese Metapher damit gemeint oder was verbirgt sich hinter dem Begriff Digital Zebra?Svaneeng:[14:42] Genau, also die erste Frage, relativ schnell beantworten, die Begeisterung der Berliner Politik ist dann sehr groß gewesen, als wir das so präsentiert haben, auch weil Sie verstanden haben, wir machen das immer noch so. Also das Ursprungsziel ist, wir vermitteln primär den Zugang zu digitalen Daseinsvorsorge, aber wir können eben auch darüber hinaus, als Bibliotheken insbesondere, die ja seit der Antike Medienkompetenz, Vermittlung, Informationsbereitstellung machen, digitale Teilhabe im weiteren Sinne fördern und das wurde dann sehr positiv aufgegriffen. begriffen. Zum Thema Zebra. Wir haben einfach gemerkt, dass das Thema Digitalisierung, das Digitale ist mit sehr viel Charme besetzt bei ganz vielen Menschen. Menschen mit geringer Literalisierung, Menschen plus fünf und sechzig, die vielleicht nicht bestimmte Kompetenzen erworben haben in dem Arbeitsleben oder sind Menschen, die Schwerbehinderung haben. Das sind alle möglichen Gründe, warum man nicht digital sein kann. Und sehr oft ist es aber sehr, sehr schwierig für diese Menschen zu kommen und zu sagen, ich komme damit nicht klar, erstaunlich schwierig, weil ich habe auch manchmal meine Probleme mit der Digitalisierung.Aber deswegen haben wir einfach gemerkt, es bringt nicht, wenn wir so einen Namen weiterverwenden wie BürgerInnenterminal, oder sowas, es soll nicht so stark nach Behörde klingen. Es muss irgendwie den BürgerInnen zugewandt sein. Es muss wirklich Ängste abbauen und wirklich gar nicht nach Bürgeramt klingen. Und dann haben wir die NutzerInnen gefragt nach verschiedenen Namen, was sie da irgendwie interessant finden. Und auch zu meiner eigenen Überraschung fanden alle das Zebra voll ansprechend und süß. Und da war eben die Anspielung dann Zebrastreifen als sicherer Übergang in die digitale Welt. Und so könnte man sagen, wir haben 24 Bibliotheken mit dem Angebot und das sind so wie 24 Zebrastreifen in die digitale Welt, die wir in Berlin etabliert haben.Lobeck:[16:25] Genau. Jetzt hast du das mit den 24 erwähnt. Wie viel gibt es insgesamt? Weißt du das? Gerade auswendig? Pi mal Daumen?Svaneeng:[16:34] Also es gibt 24 Bibliotheken, die als Standorte des Projekts mit dieser Beratung funktionieren. Und es gibt insgesamt 82 Bibliotheken des Verbundes der öffentlichen Bibliotheken.Lobeck:[16:45] Und sind das jetzt speziell ausgewählte? Also habt ihr gesagt, okay, wir nehmen jetzt die in den und den Stadtteilen? Oder hat das was mit einer Gebietskulisse zu tun, mit Förderung oder irgendwie sowas?Svaneeng:[16:55] Das hat teilweise mit Förderung zu tun. Also wir sind gefördert auch durch die ressortübergreifende Gemeinschaftsinitiative. Das ist eine Initiative zur Beteiligung von, also zur Stärkung von sozialökonomisch benachteiligten Quartieren. Und ein Teil der Standorte sind in dieser Förderkulisse und werden auch aus diesen EU-Mitteln finanziert. Und die Standorte außerhalb der Förderkulisse werden dann von Haushaltsmitteln oder aus anderen Mitteln finanziert. Also dementsprechend komplex sehen meine Excel-Tabellen dann auch aus.Lobeck:[17:27] Okay. Und das ist aber, das ist erstmal, wenn wir über Fördermittel sprechen, dann ist es ja oft so, es ist ein befristetes Projekt, oder?Svaneeng:[17:36] Es ist ein befristetes Projekt, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht nochmal als Zentralbibliothek nur eine Gruppe von ProjektmitarbeiterInnen einstellen, die dann rausgehen in die Bezirke, die alle eigenständige Arbeitgeber sind und dann machen sie irgendwas Schönes für drei Jahre und dann gehen sie wieder. Es gibt viele tolle Projekte, die dann einfach nicht weitergeführt werden, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das versuchen, ein bisschen anders zu machen und deswegen haben wir uns die große Kopfschmerzen auf uns genommen und haben gesagt, es gibt für jeden Bezirk Einstellungsprozesse für jeden einzelnen Mitarbeiter und die werden dann vorrangig auch als Mitarbeiter in der jeweiligen Bibliothek dann eingestellt. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Menschen nicht sozusagen als Mitarbeiter in der Bibliothek, also als ein Projekt in der Bibliothek nur wahrgenommen werden, sondern ein Projekt der Bibliothek.Und sollte jetzt das Projekt ablaufen und dann verschwinde ich zwar, weil ich bin fast der einzige Projektmitarbeiter zusammen mit meinem kaufmännischen Counterpart und der Projektkoordinatorin, aber alle anderen sind weiterhin MitarbeiterInnen, die schon seit langem in ihren Teams arbeiten. Und wir haben dann einfach einen Vertrag mit den Bezirken gemacht und gesagt, wir stellen ihnen für drei Jahre erst mal Geld zur Verfügung, um auch eine etwas bessere reduzierte Stelle zu ermöglichen, wo sie dann auch ein bisschen Personalentwicklung betreiben können oder eine attraktive Stelle für ihre Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen. Das war so der Gedanke und auch eine Verstetigungsstrategie, die dabei mitbedacht wurde. Aber die Einstellungsprozesse waren komplex und haben sehr lang gedauert.Habbel:[19:13] Kannst du noch was zu den Bedarfen sagen, inwieweit die sich entwickeln? Man könnte ja die These vertreten, die Smartphones werden immer einfacher und damit dürfte die Beratung zurückgehen. Aber ich vermute mal, das wird nicht so sein. Vielleicht sogar das Gegenteil. Kannst du da was zu sagen, wo sich da diese speziellen Bedarfe hin entwickeln und ob sie steigen auch, wenn man mal so eine Zeitreihe betrachtet, eure Arbeit in den letzten Monaten oder Jahren?
Herausforderungen und LösungsansätzeSvaneeng:[19:41] Ja, also das glaube ich, das kann man gar nicht so sagen. Also ich habe auch allgemein den Eindruck in Deutschland, ich komme ursprünglich aus Dänemark und manchmal bin ich ein bisschen erstaunt, wenn ich dann die deutsche Forschung dazu lese, wie stark binär die Sprache immer noch ist. Also es gibt Offliner und Onliner immer noch, höre ich. Und tatsächlich, die Menschen, die wir helfen, unterstützen, wie gesagt, 400.000 Menschen haben eine Schwerbehinderung. Zum Beispiel, wenn ich eine Sehbeeinträchtigung habe, dann bin ich vielleicht, es kommt eine blinde Person zu uns, die braucht Sprachsteuerung. Es gibt aber auch Menschen, die haben einen Fleck mitten in der Auge und können nur so aus dem Winkel sehen. Da hilft es nicht, dass ich die Kontraste ändere. Es gibt Leute, die sehen es schwammig, die brauchen aber genau das.Und dann sagt es die Person, ich frage die Person, haben Sie die allgemeine Geschäftsbedingungen gelesen? Und die Person sagt, ich habe nicht meine Brille dabei. Jetzt könnte ich was tun, aber ich habe auch gelernt, dass Menschen, die das sagen, vielleicht auch nicht gut lesen und schreiben können. Also das haben wir bei einer Sensibilisierungsschulung vom Grundbildungszentrum gelernt. Also muss ich auch darauf eingehen. Es gibt so viele Gründe, warum die Digitalisierung mit Barrieren versehen sein können. Wir haben über eine Million Menschen mit Migrationshintergrund, wo einfach Beamtendeutsch eine Barriere ist und wo man auch damit alleingelassen wird, wenn man online unterwegs ist. Und all das zu berücksichtigen, ist natürlich so ein bisschen unsere größte Herausforderung. Da können wir gar nicht nachvollziehen, dass eine bestimmte Entwicklung in irgendwelcher Form das irgendwie eindeutig ändert. Und KI ist eine Chance für uns, gerade im Bereich Übersetzung anderer Dinge, aber auch in anderer Hinsicht eine Herausforderung, weil gerade die natürliche Sprache und die Sprachkenntnisse sind sehr wichtig, um ein KI effektiv bedienen zu können. Und ja, das muss man dann auch irgendwie meistern. Das ist nicht selbstverständlich.
Ausbildung und Rolle der Digitallotsen
Lobeck:[21:26] Das ist auch was, was ich wirklich spannend an dem Projekt finde, dass ihr sozusagen in der Lage seid, auf diese Vielfalt, der Bedürfnisse einzugehen. Also das finde ich schon wirklich einen sehr beeindruckenden Punkt. Ich finde auch die Verankerung in der Bibliothek total toll, also genau mit den verschiedenen Möglichkeiten, die du auch schon geschildert hast und den Verlinkungen. Was ich aber ja eine spannende Frage nochmal finde, ist, diese Digitallotsen und -lotsinnen müssen ja dann schon ziemlich viel können, finde ich. Also sie müssen einen guten Überblick haben, sie müssen sehr kommunikativ sein, sie müssen das alles so mitkriegen. Wie bildet ihr die aus oder wie habt ihr die ausgebildet oder bildet die weiter? oder?Svaneeng:[22:07] Man braucht, glaube ich, als Digitallotsin oder Lotse in erst mal zwei Sachen. Man muss mutig sein und man muss zuhören können. Wenn man das kann, dann kommt man sehr weit, weil wir fangen tatsächlich unsere Beratungsgespräche oft an mit dem Satz, ach, das habe ich auch noch nicht probiert, aber gemeinsam finden wir das bestimmt heraus. So, ganz offen. Und die Menschen kriegen dann auch mit, weil die Anliegen sind ja so vielfältig wie die ganze digitale Welt, wie die Personen, wie die Lotsin oder Lotse ein Problem angeht, wie sie recherchieren, wie sie so einer Lösung kommen. Und da ist es ganz wichtig, dass ich habe im früheren Leben, war ich Lehrer und da lernt man auch sehr schnell, wenn man sich vor den Kindern hinstellt und sagt, ich weiß das alles und man weiß es dann nicht, dann ist man erledigt. Also lieber mit dieser Offenheit anfangen. Wir versuchen gemeinsam schlauer zu werden und das lässt dann sehr viel tolle Gespräche und tolle Erfahrungen für alle zu und ich glaube, Ob der Kompetenzerwerb, der da stattfindet, ist auch besser, weil es ist nicht nur, ich werde jetzt von einem Experten belehrt und das war es und ich muss mir alles merken.Und wir haben aber dann auch so komplexe Anliegen, wo wir das nicht gleich lösen können. Zum einen sind wir dann sehr umfassend geschult, darauf kann ich nochmal zurückkommen. Also die Lotsinnen, die jetzt von Anfang an im Projekt dabei sind, haben jetzt über 62 verschiedene Schulungen besucht. Das andere ist aber auch, dass wir dann sowas sagen können wie, das weiß ich nicht spontan, aber kommen Sie nochmal am Dienstag nächste Woche. Das Thema würde ich gerne mitnehmen in die LotsInnen-Konferenz.
Die LotsInnen-Konferenz ist eigentlich nur unser Team-Site, aber nach außen sagen wir LotsInnen-Konferenz, weil das kommt gerade für einige Menschen so vor wie so eine Ärztekonferenz. Dann stellt man sich vor, die Lotsenden berlinweit sitzen in weißen Kitteln und reden über meinen Laptop und es schmeichelt ein bisschen. Und da finden wir normalerweise dann immer ein Problem, weil wir Zeit haben. Aber das Allerwichtigste für uns, glaube ich, ist, dass wir immer gesagt haben, wir wollen einen Mehrwert für die Leute generieren. Das heißt nicht, dass wir immer eine Lösung für das Problem finden. Also, ich finde dann, ich recherchiere, ich stelle fest, das kann ich nicht lösen, aber ich recherchiere, wer es dann lösen könnte. Und vielleicht ist die Mehrwert dann einfach nur, dass ich mich ernst genommen gefühlt habe, dass es das Problem richtig ist, dass ich das eingeordnet habe, dass die Person vielleicht für mich eine Wegbeschreibung ausdruckt und mir mitgibt, wie ich dann so diese anderen Stelle hinkomme, wo dann tatsächlich Linux-Installationen von einem gemeinnützigen Verein betrieben werden oder irgendwie angeboten werden. Und das genau, also diesen Netzwerkcharakter hilft uns dann eigentlich immer so einen Mehrwert für die Nutzerinnen zu ermöglichen.
Skalierung und Übertragbarkeit des Projekts
Habbel:[24:52] Ja, spannend. Ich finde das Projekt wirklich superklasse. Mein Thema ist auch gerade bei der Digitalisierung Skalierung. Und wir haben in Deutschland 8800 öffentliche Bibliotheken. Berlin ist die größte davon. Wie können die anderen 8.799 von dieser Leistung, von diesem Service profitieren? Gibt es auch schon Anfragen anderer Bibliotheken und wo würdest du die Grenze der Größe sehen? Es gibt ja auch kleinere Städte, Deutschland ist ein Flächenland im weitesten Sinne, wo vielleicht 10.000 Einwohner in der Gemeinde sich befinden, in der Bibliothek drei Mitarbeiter, zwei oder drei Mitarbeiter arbeiten. Wie kann eine solche Serviceleistung auch dort wirken oder muss man sich da andere Konzepte vorstellen, die auch vielleicht stärker virtualisiert sind? Und also zunächst mal die Frage, wie kann man diese super Innovation, die hier in Berlin entstanden ist, in die Fläche bringen?Svaneeng:[25:59] Genau, also ich glaube erstmal sind die Erfahrungen natürlich sehr stark auf ein Ballungsgebiet, auf die Hauptstadt bezogen. Und das ist natürlich eine Besonderheit. Und ich glaube, was gerade das Angebot so gut ankommen lässt, also wir rechnen ja damit, dass wir bis Ende des Projekts vielleicht bis zu 100.000 Beratungen durchgeführt haben. Das ist nicht wenig und sind ja zum Teil sehr, sehr intensive Gespräche und Beratungen, die auch sehr lange dauern. Das ist jetzt nicht nur kurz abfertigen und das war's. Aber... Ich glaube, was wir erstmal bei uns festgestellt haben, ist, dass wir erstmal nicht alle Bedarfe selber decken können. Also zum Beispiel, als wir angefangen haben, haben die Leute angefangen, uns anzurufen in der Bibliothek und gesagt, ich bin nicht mehr so mobil, ich würde aber so gerne zum Zebra kommen, können Sie mich nicht telefonisch beraten. Also haben wir gedacht, wer macht dann Telefonberatung, weil wir können das selber nicht leisten. Und dann sind wir auf Silbernetz zugegangen, einen Verein, das für einsame Menschen-Hotlines einrichtet. Und die haben dann ein Digitaltelefon für uns eingerichtet oder mit uns zusammen. Und da bin ich dann auch auf das Senat zugegangen, habe gesagt, könnten wir da nicht eine Extrafinanzierung bekommen, zusammen mit ihnen. Und jetzt kann man dann auch sozusagen die anrufen und dann einfach telefonisch erfahren, wo ist die nächste Beratungsstelle oder was muss ich hier klicken, also wenn ich eben nicht in die Bibliothek kommen kann. Und wir machen das dann auch umgekehrt. Also wir können sogar so denen sagen.Also wir hatten zum Beispiel eine Dame, die hat ein Problem mit einem Gerät, aber in Wirklichkeit war das Problem, dass sie einen Router in die Wohnung gestellt hat und dachte, wie das Radio oder sowas, es strahlt jetzt Internet aus. In Wirklichkeit musste das erst installiert werden. Dann haben wir beim Hotline angerufen. Das Hotline hat dann bei nebenan.de für Zebra eine Anzeige erstellt, dass die Frau Hilfe braucht. Ein Nachbar hat sich dann beim Telefonhotline gemeldet und ist dann in die Wohnung gegangen und hat dann den Roda für die Frau installiert. Also es funktioniert in verschiedene Richtungen. Aber das lebt davon, dass wir so eng aufeinander sind. Dass wir auch zum Beispiel, wenn ich Schlangenbildung habe oder wenn ich diese Kontakte habe, dass ich wirklich meinen Kiez kenne, dass ich immer an den nächsten Standort einen U-Bahn das schon weiterverweisen kann. Wie das im Dorf jetzt aussehen würde oder in einer kleinen Stadt, Da glaube ich, kann man schon einige Sachen übernehmen. Ich würde gerade vom Service-Design, von diesen ganzen Workarounds, das ganze Mindset, was zu diesem Service gehört, da glaube ich, da kann man schon viel übernehmen, aber es wird von der Qualität und von dem Angebot her auch anders sein. Also jetzt die 20 Stunden Regelservicezeit in einem kleinen Dorf hinzusetzen, also das macht wahrscheinlich wenig Sinn.Aber gerade auch viele Ängste bei den BibliotheksmitarbeiterInnen abzubauen und auch so diese Frage zum Beispiel bei Online-Banking, da sagen ja viele auch, muss ich denn wirklich mich einloggen bei der Bank einer Person? Und da haben wir immer gesagt, nee, also wir wollen Mehrwerte. Deswegen haben wir dann von den Banken angefragt, ob wir so Dummies, Klick-Dummies bekommen. Und so können wir jetzt immer als Max Mustermann stattdessen reingehen und dann zeigen, so sieht eine Überweisung aus, so machen sie das, aber ohne, dass wir jetzt wirklich mit personenbezogenen Daten da irgendwie uns durchklicken müssen. Also das sind so Sachen, die mitzugeben und das zu erklären, Ängste zu nehmen und diesen Fokus auf den Mehrwert statt dieses Experten, Experte sein müssen, das braucht ziemlich viel Vermittlung. Und ich glaube, wenn das in vielen Orten ankommen würde, dann könnte man auch ortsgerecht sozusagen Zielgruppen bezogen ein eigenes Angebot stricken, sei es jetzt eine Sprechstunde, sei es irgendwie eine Art von mobile Beratung und so weiter. Also ja, es gibt einen Transfer, der definitiv möglich ist und wir haben auch Anfragen, auch aus meiner Heimat, aus Dänemark oder aus Wien Interesse dafür sogar gehabt, aber auch in Deutschland gibt es dann immer mehr, vor allem Ballungszentren oder Städte, also wir haben jetzt Kontakt auch mit Hamburg gehabt oder mit, ich glaube, das war Aachen, was sich jetzt letztens gemeldet hat. Also verschiedene Orte Deutschlands. Und wir haben auch die Webseite erst mal nur registriert als digitalzebra.berlin und eben nicht DE, weil die Offenheit da ist, man könnte auch einen digitalzebra.münster machen. Das ist kein Thema.Lobeck:[30:09] Ja, das ist wirklich super spannend. Ich habe auf der republica auch noch eine quasi Kollegin von dir kennengelernt. Ich habe jetzt leider den Namen nicht präsent. Die hat die Gertrud Junge Bibliothek vorgestellt, die sie leitet in Gropius statt und fand auch ganz spannend, dass sie eben auch gesagt hat, dass das eine super Ergänzung ist sozusagen für ihr Portfolio, was sie halt haben. Die sind gerade irgendwie rumgebaut worden, haben jetzt irgendwie noch Kinder, Jugend ausgeweitet. Könntest du sagen oder gibt es irgendeinen Eindruck davon, ob ihr, ich sag mal, irgendwie habt ihr ein Gefühl dafür, gibt es unterschiedliche Fragen, die aus unterschiedlichen Orten gestellt werden? Also ich hatte nur gerade diese Bibliothek vor Augen und fragte mich, ist das da anders als in, keine Ahnung, in Schöneberg? Oder ist das irgendwie alles so wild durcheinander oder ganz vielfältig, wie du es geschildert hast? Oder gibt es irgendwelche, wenn die sich so austauschen?Svaneeng:[31:08] Definitiv, Berlin ist wirklich eine Stadt mit vielen Welten, würde ich sagen. Und das ist mit einer stark verankerten Kiezstruktur. Die Identität fängt wirklich an mit der Straße und dann mit dem Kiez und dann mit dem Bezirk und so. Und dann irgendwann Ost und West vielleicht auch noch spielt eine Rolle. Also das sind so Sachen, die man auf jeden Fall spüren kann an jedem Standort. Und ich genieße gerade sehr, dass wir so eine Entwicklung sehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine der größten Bibliotheken nehmen, wie zum Beispiel die Zentralbibliothek. Da ist das Publikum eher etwas männlicher als sonst in den Bibliotheken. Das formale Bildungsniveau ist etwas höher als zum Beispiel in den kleinen Stadtteilbibliotheken. Und die ersten Anfragen, die wir dort bekommen haben, waren sehr viel zu E-Reader, ein Museumsticket bestellen oder irgendwelche andere Sachen. Und ich habe dann die ganze Zeit danach geschaut, weil es ist ja auch wichtig für die Bibliotheken als Strategie, dass wir uns stärker zu dritter Orte verwandeln und nicht nur Bücherhallen sind.Und ich habe die ganze Zeit in unserer Statistik von den Anliegen, wir kriegen ja mittlerweile wirklich ein Live-Bild von was die Berlinerinnen gerade für Probleme haben, weil wir so viele Standorte uns mit anonymisierten Daten zuspielen. Und da in der Zentralbibliothek habe ich dann gewartet und gewartet. Ich war schon ziemlich frustriert, weil ich war müde von diesen ganzen E-Readern. Und irgendwann habe ich dann gesehen, Jobcenter-Termin oder andere Anliegen. Und es sprach kurz beim VHS und so weiter. Und dann haben wir gemerkt, okay, da haben wir auch mit diesem neuen Angebot ganz neue Zielgruppen da in die Bibliothek reingeholt und vielleicht auch wirklich eine Bibliotheksentwicklung damit vorangetrieben. Und ich glaube, das ist auch am Cottbuser Tor ganz anders, als das jetzt in Marienfelde ist.Habbel:[32:59] Nun ist Berlin ja auf der Suche nach einer neuen Räumlichkeit für die Zentralbibliothek. Wäre es nicht schlau, ein solches Konzept auch stärker auf diese veränderten Fragen und Dienste auszurichten und auch quasi ein anderes Zugangsmodell oder Präsentationsmodell von Wissen von Bibliothek, ansetzen und hier von dieser Unterstützung auch räumlich neu abzugrenzen oder aufzubauen.
Zukunft der Bibliotheken und Integration in die Verwaltung
Habbel:[33:29] Was zu der Frage, wie so eine neue Zentralbibliothek unter diesem steigenden Bedarf da auch aussehen könnte, weil es ja nicht nur mal eine Bücherhalle geht. Und die zweite Frage war, die Erkenntnisse, die ihr gewinnt, auch wie Menschen, auch behinderte Menschen mit Problemen hier konfrontiert werden, wo sie Lösungen suchen, wird dieses Wissen auch in andere Bereiche der Verwaltung getragen? Dass beispielsweise im Sozialamt, Jugendamt oder Ausländeramt man davon Kenntnis hätte, um eine vielleicht noch zielgenauere Dienstleistung in dem Sektor dieser Ämter gerade anzubieten und das Ganze miteinander zu verschränken und zu vernetzen. Also viel darauf hinaus, so einen holistischen, ganzheitlichen Verwaltungsansatz auch hier in den Raum zu stellen, wie man damit umgeht. Und da seid ihr ja eine super Basis für, auch hier sehr konkret an den Problemen der Menschen euch aufzuhalten und die auch zu antizipieren, wo die Dinge hingehen. Und dieses Wissen quasi auch in die Verwaltung generell hineinzutragen. Das wäre mal so die zweite Frage nach dieser räumlichen Arrondierungsthematik.Svaneeng:[34:38] Ja, also klar, die Bibliotheken, so wie sie jetzt gebaut ist, also die Zentralbibliothek jetzt ist getrennt in Ost und West, in der Ostbibliothek und der Westbibliothek, also noch aus Seiten der Mauer. Und ich fahre dann immer mit dem Fahrrad über Checkpoint Charlie, um in mein Westbüro zu kommen. Und das eine Gebäude ist das älteste Gebäude Berlins, ein altes Mittelaltergebäude und das andere ist so ein modernistisches Gebäude, was irgendwie von den Amerikanern in den 50er, 60er Jahren hochgezogen wurde. Und die Nutzungsfläche ist eigentlich nur für Bücher ausgerichtet, also nicht für Begegnungsräume, nicht als dritter Ort wirklich. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Zukunft. Wir brauchen dringend mehr Raum für Programmarbeit, für Begegnung und auch für diese Aufenthaltsräume der niedrigen Intensität. Das ist, was ich immer so genossen habe. Ich bin mein ganzes Leben von Land zu Land gezogen und viel umgezogen und war natürlich erstmal in einem neuen Land immer allein. Und dann waren die Bibliotheken immer so für mich besondere Orte, weil da kann man gemeinsam allein sein. Da braucht man nicht ein Handy oder eine Ausrede. Es sind keine kommerziellen Orte. Ich muss auch kein Geld ausgeben, sondern ich kann einfach ein Buch nehmen, an meinem Projekt arbeiten und auch mich vernetzen mit anderen Leuten, die ähnliche Interessen haben.Und dann natürlich gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland, also die Menschen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren in die Rente gehen, die brauchen wir dringend auch weiterhin für die Gesellschaft. Die können wir nicht einfach so in Rente gehen lassen. Und für sie braucht es auch dritte Orte, wo diese Menschen ehrenamtlich eingebunden werden können. Sich vernetzen und aktiv bleiben in unserer Gesellschaft. Und auch da verstehe ich nicht, warum diese Räume nicht stärker priorisiert werden aus Sicht der Politik. Wenn wir nach Skandinavien schauen, sozusagen der zum Beispiel nach Oslo geht, wo die Deichmann-Bibliothek wirklich sozusagen ein Palast der Öffentlichkeit ist, wo man wirklich mitten im Zentrum weltbekannt ist irgendwie und was man dort täglich erleben kann, das ist wirklich eine ganz andere Liga und ich hoffe mir dringend, dass diese ganze Vielfalt, dieses ganze Potenzial, was in Berlin steckt, also das hat ja eine Kreativität, mit der sich eigentlich Oslo nicht messen kann, wenn das sich irgendwie, ja, ein Ort zum Leben bekommen würde, dann wäre das auf jeden Fall ein maßgeblicher Schritt für die ganze Entwicklung der Stadt. So der anderen Frage ist, Das war nochmal bezogen auf...Habbel:[37:23] Wie kommt das Wissen von euch in andere Fachbereiche der Verwaltung, die mit diesen Erkenntnissen arbeiten könnten?Svaneeng:[37:29] Ich habe lange versucht, das ganze Thema auch nochmal so aufzumachen, als wir bauen doch eigentlich hier ein agiles, unständiges Testzentrum für die menschenzentrierte Entwicklung digitaler Produkte. Also das wäre fast von den Zahlen, die wir da, von den Begegnungen, die wir tatsächlich haben, nicht mal eine menschenzentrierte Entwicklung, es wäre eine demokratische Entwicklung fast von digitalen Produkten, weil wir wirklich so viele Menschen mit eine Stimme geben könnten und mit einbinden könnten. Und es hätte auch den Vorteil, dass man Interessengruppen, die alle ihr Vorgaben machen und dann in einen langen PDF-Dokumenten einpacken und zum Teil widersprechen sie sich auch. Ich kann total verstehen, warum sie das machen. Ich will das gar nicht schlechtreden. Das ist total nachvollziehbar. Aber es ist eben, wenn man Programmierer fragt oder Entwickler, ist es wahnsinnig schwierig, diese verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen.Das muss man aber einerseits hinbekommen. Andererseits, wenn man unsere NutzerInnen fragt, kann man auch ganz schnell merken, dass für viele für sie sagen sie, ja, das sind die zehn Punkte, die für mich eine Barriere darstellen. Aber 90 Prozent ist eigentlich nur, wenn dieser roter Button mit online mal oben gerückt worden wäre, dann hätte ich, das wäre die halbe Miete. Die können auch Prioritäten setzen. Und ich finde das eigentlich eine sehr spannende Gelegenheit, um stärker ins Gespräch zu kommen. Es gibt jetzt auch Gespräche. Es gibt auch Hochschulen, die da Interesse angekündigt haben und daran arbeiten, vielleicht auch Fördergelder dafür zu bekommen, auch gerade um zum Beispiel so KI-Assistenzsysteme zu testen mit uns gemeinsam.Was daraus wird, da bin ich sehr gespannt und ja, mit der Verwaltung ist es halt immer das Ding also wir sind offizielle Maßnahme der Berliner Digitalstrategie, aber ob man wirklich also man kann halt nicht nach Organigramm gehen, man muss da irgendwie zufällig auf die Person stoßen, die die gleiche Leidenschaft hat und die irgendwie und dann kommt die vielleicht auch so eine Ecke, die man gar nicht erwartet hat, aber wird dann irgendwie so treibende Kraft bei der ganzen Sache und die Person so finden und so eine kleine Bewegung für so ein Anliegen so bilden, das ist, Und ja, das ist viel Arbeit und ich habe aber auch das Gefühl, dass das von vielen auch eine Chance verstanden wird.
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Veröffentlichung von Erkenntnissen
Lobeck:[39:35] Ja, das finde ich spannend. Das ist lustig. Ich hätte eine Frage auch in die ähnliche Richtung gehabt, also wie sozusagen eure Erkenntnisse, du hast das ja schon geschildert, dass du quasi ein Live-Monitor hast, in Anführungsstrichen, was sozusagen ein Anliegen da rum ist, ob ihr das schon mal auch veröffentlicht habt, ob ihr mal das gezeigt habt, um auch eine Anschlussmöglichkeit eben nochmal anzuregen. Also ob jetzt in der Verwaltung oder wie Franz Reinhard ansprach für andere Bibliotheken oder vielleicht noch für ganz andere Leute, die jetzt außerhalb von Bibliotheken trotzdem sagen, oh, das ist eine spannende Geschichte, das können wir uns mal anhören. Gibt es da was? Habt ihr da irgendwie schon mal was zu Papier gebracht, was man weiterempfehlen könnte, wo Leute mal reinschauen könnten?Svaneeng:[40:13] Wir sind dabei, das zu machen. Zahlen liefern ja nicht immer Antworten, sondern sie helfen, gute Fragen zu stellen. Und das ist ein bisschen das, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben ganz viele uns Fragen gestellt, also gerade so Entwicklungen, verschiedene Zielgruppen, Anliegen und so weiter. Wir haben auch festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir aber die Anliegen registrieren, überarbeitet werden mussten, weil zum Beispiel haben wir dann eine Kategorie gehabt bei den Anliegen, die allgemein war, runterladen von Apps und Bedienung von Endgeräten. Und ganz viele Lotsenden haben das natürlich sehr viel angegeben. Es gibt auch eine andere Kategorie, da heißt es Gesundheitsvorsorge.Digitale Gesundheitsvorsorge. Und manchmal haben die Lotsenden, wenn sie dann eine App runtergeladen haben, für AOK, sage ich mal, haben sie dann Apps runtergeladen, angegeben. Manchmal haben sie die Gesundheitsvorsorge markiert. Und bis wir dann irgendwie verstanden haben, dass das sich überschneidet, ob man eigentlich die Barriere oder das Ziel des Anliegens erfasst, verschiedene Ergebnisse produziert, haben wir da ein bisschen nachsteuern müssen. Und wir haben das ja auch lange pilotiert und deswegen haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, das Projekt wird ja voraussichtlich noch mit seinem Projektstatus verlängert und wir hoffen, dass es läuft bis 2028, und da wir jetzt auch das Rollout voll abgeschlossen haben und wirklich vollumfänglich in allen Bezirken unterwegs sind, kommt jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Datensatz zusammen, den wir dann auch selbstverständlich dann publizieren wollen und mit dem wir dann auch ins Gespräch gehen wollen mit verschiedenen Ämtern und der Öffentlichkeit.
Nachfrage der Generation Z
Habbel:[41:46] Wie hoch ist denn die Nachfrage der Generation Z? Das sind ja die Menschen, die zwischen Mitte der 90er Jahre und Anfang der 20er Jahre geboren sind. Ist die relevant, diese Gruppe? Oder würdest du sagen, naja, die können auch alles, außer sie sind jetzt im Bereich, wo sie gehandicapt sind, alles andere können die? Oder kann man das nicht so feststellen?
Svaneeng:[42:10] Das kann man nicht ganz so feststellen. Also klar, über 50 Prozent unserer Beratungssuchenden sind plus 65. Also das ist das schon. Ältere Menschen sind eher bei uns sind. Ich meine mich zu erinnern, dass die Menschen, die jüngste Alterskohorte, also Teenager und ganz junge Erwachsenen, also auch Kinder, stellen ungefähr 14 bis 15 Prozent der Beratungssuchenden dar. Aber da haben wir aber auch wirklich junge Menschen, die kommen und die sind dann jeden Tag auf TikTok unterwegs und dann sagen sie dann, dann sagt die Beratungs-, die Beratenden dann, das machen wir lieber mit der Maus. Das ist zum Beispiel, die müssen sich für ein Praktikum bewerben und dann fragt die Person, was ist ein Maus? Also da haben sie noch nicht ein Maus bedient. und ich gehöre noch zu der Generation an, wo wir mindestens in Dänemark EDV-Unterricht in der Schule hatten. Es gab dann eine lange Zeit, wo in vielen Schulen dann gesagt wurde, naja, die sind ja damit geboren, brauchen sie doch alles nicht. Es gibt aber einen großen Unterschied, ob ich eine App bediene und sozusagen mit meinem Bauchgefühl das mache oder ob ich dann doch noch irgendwie einen theoretischen Rahmen brauche oder etwas wir missen, um zum Beispiel Textbearbeitungsprogramme und so weiter zu verwenden. Wie sich das weiterentwickelt, weiß ich nicht, Aber definitiv kann man nicht so pauschal sagen, dass die jungen Menschen das gar nicht brauchen. Vor allem, wenn es um Daseinsvorsorge geht, sind sie herausgefordert.Habbel:[43:33] Wir könnten jetzt noch weiter diskutieren und der Frage nachgehen, ob TikTok möglicherweise ein Wettbewerber ist für diese Geschichte. Aber die Zeit ist fast schon zu Ende. Du hast am Anfang gesagt, du kommst aus Dänemark. Mein Schlusssatz ist, wir brauchen mehr Dänemark in Deutschland. Das finde ich außerordentlich attraktiv und spannend, aber das letzte Wort soll Michael haben.Lobeck:[43:55] Ja, von meiner Seite herzlichen Dank, Jacob. Ich fand das ganz spannend, also einmal das Projekt vorstellen. Ich finde auch sehr schön, wie du das vorstellst und viele sozusagen sehr anschauliche Dinge erzählen kannst und wünsche mir jetzt einfach nur, dass viele Bibliotheken das hören und sich denken, oh wow, das ist eine super Sache. Also viele Städte erstmal das hören und mitkriegen. Das ist eine super Sache. Und du dann demnächst jetzt leider dann ganz viel Arbeit hast, weil du dann viele Anfragen bekommst und Leute das alle mitbekommen wollen. Ja, dann herzlichen Dank dir. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.Svaneeng:[44:30] Und auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für eure Arbeit. Und genau, also wie gesagt, ich bin froh, wenn Leute sich melden. Wir sind jetzt an einem guten Punkt und können genau diesen Schritt jetzt auch gehen und konkrete Erfahrungen teilen. Und auch dieses Thema, was ich noch gar nicht angesprochen habe, dieses ganze Schulungsprogramm, was eigentlich da die Berliner Polizei, die Verbraucherzentrale, wer uns da alle, die ganze Zielgruppenvertretung, die uns da geschult haben, Sehbehindertenverband oder also wer auch immer uns da befähigt, um diese Arbeit zu machen. Weil da kann man bestimmt auch ganz viel teilen und schnell ein agiles Programm auch für Lotsinnen und Lotsen in anderen Teilen Deutschlands was aufsetzen.Lobeck:[45:08] Wunderbar. Ja, dir herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Auch herzlichen Dank. Und falls Sie noch Ideen haben, falls wir noch andere Themen besprechen sollen, die Sie interessant finden, melden Sie sich einfach bei uns bei info@habbelundlobeck.de. Das erreicht uns beide. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer.